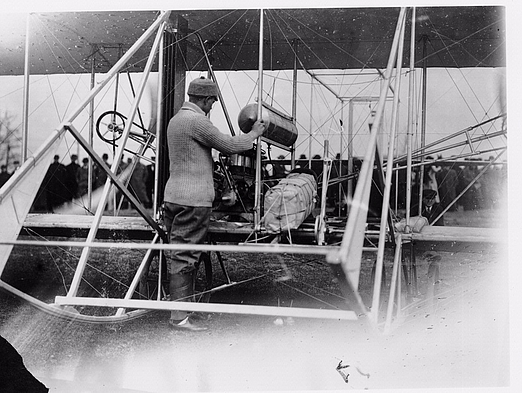Der zivile Überschallflug soll erneut abheben
Rückkehr der Über(schall)flieger
- Insights
Nach über zwei Jahrzehnten Stille erwarten Überschall-Passagierflüge nun ein Comeback. Ursprünglich für militärische Zwecke entwickelt, hielten Überschalljets 1968 mit der legendären Concorde Einzug in die kommerzielle Luftfahrt. Obwohl die Concorde ihren letzten Flug 2003 absolvierte, erlosch der Traum vom Hochgeschwindigkeitsflügen auch danach nie. Jetzt wird diese Vision wiederbelebt und neu konzipiert: Das Ziel ist, das Reisen noch schneller und attraktiver zu machen. Im Januar 2025 erreichte Boom Supersonic, einst ein kleines US-Startup, einen wichtigen Meilenstein. Erfahren Sie mehr über die kühnen Pläne, einen verkleinerten Prototyp, volle Auftragsbücher und einen sowjetischen Vorgänger der Concorde…